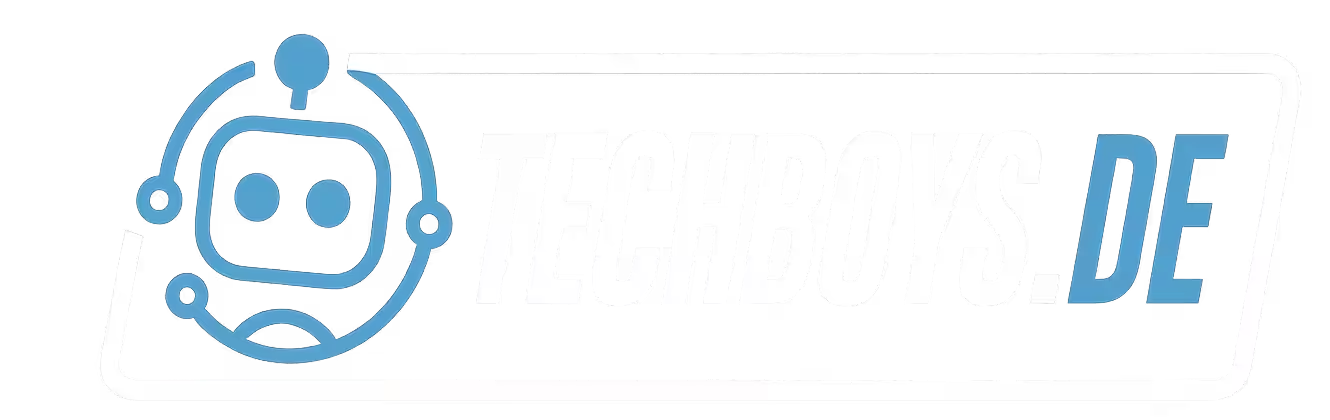Ein persönlicher Rant, ein Liebesbrief und ein Abgesang auf Stranger Things – über Freundschaft, Verlust, die Lüge der Nostalgie und warum Steve Harrington verdammt noch mal der beste Sexualkundelehrer der Welt wäre. Achtung: Spoiler.
- Stranger Things Kapitel 1: Das Knacken in der Ecke (oder: Wie wir 2016 die Unschuld verloren)
- Stranger Things Kapitel 2: 5 Staffeln, 10Jahre, ein Gefühl
- Stranger Things Kapitel 3: Die Lüge der Nostalgie (Bericht eines Zeitzeugen, Jahrgang 1980)
- Stranger Things Kapitel 4: Wo sie wirklich gelandet wären (oder auch nicht)
- Stranger Things Kapitel 5: Und wenn alles nur ein Spiel war?
- Stranger Things Outro: Was bleibt
Stranger Things Kapitel 1: Das Knacken in der Ecke (oder: Wie wir 2016 die Unschuld verloren)
Wir müssen zurückspulen. Nicht in die 80er, sondern ins Jahr 2016. Eine Zeit, die sich mittlerweile fast genauso weit weg anfühlt wie 1983. Die Welt war noch eine andere, oder zumindest bildeten wir uns das ein. Trump war noch ein schlechter Witz, Corona eine Biermarke, und Netflix war dieser coole neue Ort, an dem man Dinge fand, die das normale Fernsehen sich nicht traute.
Ich erinnere mich präzise an diesen Abend. Meine Frau und ich hatten gerade eine der ersten Folgen von Stranger Things gesehen. Wahrscheinlich die, in der das Licht zum ersten Mal hysterisch flackert oder die Wand sich wölbt wie eine Latexhaut, hinter der etwas Atmendes drückt. Es war spät, draußen war es dunkel, und die Wohnung hatte diese spezielle, schwere Stille, die entsteht, wenn man eigentlich dringend ins Bett gehen sollte, aber das Gehirn noch auf Hochtouren läuft, weil es versucht, das Gesehene zu verarbeiten.
In einer Pause, vielleicht holte ich Wasser, vielleicht musste ich einfach nur die Spannung abschütteln, stellte ich mich in eine dunkle Ecke des Wohnzimmers. Ich weiß nicht mehr, warum. Vielleicht wollte ich testen, ob die Atmosphäre auch ohne Fernseher funktioniert. Ob das Unheimliche auch in unserem schwäbischen Hexenhäusle existieren kann. Ich machte dieses Geräusch.
Nicht den Schrei des Monsters. Das wäre zu einfach gewesen. Zu plakativ. Sondern dieses feuchte, klickende, organische Knacken. Irgendwas zwischen einem kaputten Heizkörper, einem Geigerzähler und einem Tier, das gerade seine Hülle abstreift, um etwas Schlimmeres zu offenbaren. Ein Glucksen aus dem Schlund. Ich stand da im Schatten, unsichtbar, und ahmte das Demogorgon-Geräusch nach.
Ich lachte mich schief. Ich fand mich in diesem Moment wahnsinnig witzig, auf diese überdrehte Art, die man hat, wenn man müde und aufgekratzt ist. Ein kleiner Jungenstreich im Körper eines Erwachsenen. Meine Frau nicht. Sie zuckte zusammen. Nicht gespielt. Echt. Sie stauchte mich zurecht und fragte mich mit einer Ernsthaftigkeit, die mich sofort verstummen ließ, was verdammt noch mal mit mir nicht stimmt.

Wenn ich heute darüber nachdenke: Genau das war der Moment. Ja, Stranger Things war damals schon eine wichtige Netflix-Produktion. Es steckte Geld dahinter. Es war nicht wirklich „Indie“. Es war kein kleines, dreckiges Arthouse-Projekt, das wir zufällig auf Vimeo gefunden haben. Aber es fühlte sich so an. Bevor das massive Merchandising kam, bevor wir Hellfire Club-T-Shirts bei Primark kaufen konnten, bevor die Hype-Maschine jeden Winkel des Internets zupflasterte, fühlte es sich an, als hätten wir eine verstaubte, unbeschriftete VHS-Kassette tief im Wald gefunden.
Eine Kassette, auf der etwas verboten Gutes drauf war. Etwas, das uns gehörte. Dieser Vibe, dieses Gefühl von privater Entdeckung, von einem Geheimnis, das man nur mit Eingeweihten teilt ,ist das, was wir seitdem jagen. Und was wir, seien wir ehrlich, nie wieder ganz zurückbekommen haben. Wir haben die Unschuld des Zuschauens verloren, genau wie die Kids ihre Unschuld im Wald verloren haben.
Stranger Things Kapitel 2: 5 Staffeln, 10Jahre, ein Gefühl
So. Das waren also zehn Jahre. Aus, vorbei, Kampagne durchgespielt, Endgegner gelegt, Loot verteilt. Wir sind zurück auf Start. Stranger Things ist Geschichte.
Es fühlt sich seltsam an. Wie wenn man aus einem Haus auszieht, in dem man viel zu lange gewohnt hat. Man kennt jeden Lichtschalter, man weiß, welche Diele knarrt, man hat sich an den leichten Schimmelgeruch im Keller (oder das Upside Down) gewöhnt. Man hat dort gelacht, gestritten, vielleicht sogar geweint. Die Wände haben Echos gespeichert.
Und dann stehst du an der Tür, den Schlüssel in der Hand, die Umzugskartons sind gepackt, und du drehst dich noch mal um. Nicht, weil du was vergessen hast. Sondern um sicherzugehen, dass es wirklich vorbei ist. Dass da niemand mehr im Flur steht. Dass das Licht wirklich aus ist.

Seien wir ehrlich: Das Ende von Stranger Things war glatt. Es war verdammt glatt. Happy Ending allenthalben. Alle sind glücklich, alle sind froh, die Welt ist gerettet. Niemand Wichtiges musste im Finale wirklich bluten. Ich weiß keine Antwort auf die Frage: „Wo waren die Demogorgons im Finale?“ Ich habe kein alternatives Ende für Stranger Things parat und auch keines gefunden, das mich wirklich überzeugt hätte.
Wenn jemand Trauer zu bewältigen hat (Mike, Hopper, wir alle), dann entscheidet er sich mit einem erzählerischen Kunstgriff einfach dazu, an das Gute zu glauben. Das „Böse“ wurde nicht nur besiegt, das Portal geschlossen, der Dreck recycelt und die Müllabfuhr war auch schon da. Hawkins blüht wieder.
Normalerweise würde mein innerer Zyniker jetzt auf den Tisch hauen. Ich würde mich über „Plot Armor“ aufregen, darüber, dass die Autoren nicht den Mut hatten, uns wehzutun, wie es Game of Thrones oder Breaking Bad getan hätten. Ich würde rufen: „Das ist unrealistisch! Wo ist der Schmerz? Wo ist der Preis, den man zahlen muss?“
Aber – und das überrascht mich selbst am meisten – ich tue es nicht. Ich bin still. Dieser Kunstgriff, sich für das Happy End zu entscheiden, obwohl die Logik vielleicht dagegen spricht? Das ist vielleicht der ehrlichste Moment der ganzen Serie.
Man glaubt ans gute Ende, nicht aus Naivität, sondern weil es Mut braucht, sich Hoffnung zu leisten, wenn alles andere im Schatten liegt. Du entscheidest bewusst, an ein glückliches Ende zu glauben, weil die Alternative – die Leere, das Chaos, der Nihilismus – schlicht unerträglich wäre. Es ist kein Kitsch. Es ist Überlebensstrategie.
Wir brauchen das Happy End nicht, weil es wahr ist.
Wir brauchen es, weil die Realität es uns so selten gibt.
Wir brauchen die Lüge, die uns sagt, dass am Ende alles gut wird, damit wir am Montag wieder aufstehen können – an den Montagen, an denen nichts Neues beginnt.
Ich brauche sie gerade, weil ich nicht weiß, ob diese Hoffnung bleibt, wenn alles wieder normal wird.
Vielleicht ist es das Bild der Kinder, die in einem stickigen Keller zusammensaßen, Würfel in der Hand, die Welt im Kopf, und beschlossen haben, nicht wegzulaufen. Vielleicht ist es die Erinnerung daran, dass ich das Unheimliche nur benennen muss, um ihm die Macht zu nehmen. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl. Dieses warme, kribbelnde, leicht schiefe Gefühl, dass man auch als Außenseiter, als Nerd, als der mit den seltsamen Hobbys, Teil von etwas sein kann, das größer ist als man selbst.
Stranger Things Kapitel 3: Die Lüge der Nostalgie (Bericht eines Zeitzeugen, Jahrgang 1980)
Ich bin Jahrgang 1980. Ich war da. Zumindest so halb. Zu jung, um die komplexe Geopolitik des Kalten Krieges intellektuell zu durchdringen, aber alt genug, um die Stimmung aufzusaugen wie ein Schwamm. Wenn ich heute im Geschichtsunterricht stehe und versuche, 15-Jährigen zu erklären, was die 80er waren, gucken sie mich oft an, als würde ich von Mittelerde erzählen.
Warum triggert mich das so? Warum finde ich Walkie-Talkies geil, obwohl ich ein Smartphone mit 5G und weltweiter Flatrate in der Tasche habe? Warum sehne ich mich nach verpixelten Arcade-Games, wenn ich Fotorealismus habe? Warum kaufen ich Vinyl, wenn ich Spotify habe?
Nichts gehört uns, alles ist ein Abo, alles ist in der Cloud, alles ist flüchtig, alles kann uns morgen weggenommen werden.
Weil die 80er – zumindest in der verklärten Erinnerung – haptisch waren. Das ist das Wort, das mir immer wieder einfällt: Haptik. Widerstand. Physis. Gewicht. Wenn du Musik hören wolltest, konntest du nicht einfach „Alexa, spiel Toto“ rufen. Du musstest ein Tape einlegen. Oder ’ne Platte. Das Plastik klapperte. Du musstest spulen oder die Nadel neu ansetzen. Das mechanische Surren. Du musstest den Bleistift nehmen, wenn der Bandsalat kam, und das Band vorsichtig zurückdrehen. Du hattest eine Beziehung zu dem Objekt.
Wenn du jemanden anrufen wolltest, musstest du eine Wählscheibe drehen oder Tasten drücken, die einen physischen Widerstand hatten. Wenn du nicht zu Hause warst, warst du nicht erreichbar. Punkt. Freiheit durch Unerreichbarkeit. Dinge gehörten dir. Du hattest sie in der Hand. Heute streamen wir alles. Nichts gehört uns, alles ist ein Abo, alles ist in der Cloud, alles ist flüchtig, alles kann uns morgen weggenommen werden.
Das Retro-Gefühl, das Stranger Things dir und mir so meisterhaft verkauft (und ja, es ist ein Verkaufsgespräch, ein brillanter Trick), ist die Sehnsucht nach einer Welt, die wir anfassen können. Eine Welt, in der Fehler Endgültigkeit hatten (das Foto ist verwackelt? Pech gehabt, kein Löschen möglich, der Moment ist so konserviert) und in der man verschwinden konnte, weil kein GPS-Tracker im Rucksack steckte.
Wir romantisieren das, klar. Die Realität der 80er war nicht nur Neon und Ghostbusters. Die Realität war grau. Sie war Tschernobyl. Sie war der Kalte Krieg, das Wettrüsten, die Pershing II, die Angst vor dem atomaren Winter. Sie war saurer Regen, der die Wälder auffraß. Sie war die ständige, unterschwellige Angst, dass irgendein alter Mann in Moskau oder Washington auf den falschen Knopf drückt und wir alle in einem grellen Blitz verglühen. Die Frisuren waren keine ironischen Statements wie heute (zumindest möchte ich das beim Anblick heutiger 20-somethings gerne denken), sie waren Verbrechen gegen die Ästhetik.
Wann diese Faszination und Verklärung der 80er Jahre angefangen hat, können sicher Kulturwissenschaftler besser beantworten als ich. Mein Verhältnis zu diesem Jahrzehnt ist auch eher zwiespältig. Als Teenager fand ich sie wahnsinnig veraltet, überholt und schlecht gealtert. Musik, Filme, Frisuren, obwohl nur einige Jahre erst her, sahen aus wie aus einem anderen Zeitalter, einer Paralleldimension entstammend.
Meine erste wirklich positive 80er-Assoziation kam übrigens nicht aus der eigenen Kindheit, sondern über einen Film: Donnie Darko. Die Handlung spielt 1988, aber für mich war das Anfang der 2000er der Moment, in dem ich überhaupt begriff, dass man über diese Zeit auch anders erzählen kann. Coming of Age lernte ich damals als Begriff genau darüber. Ein Film, der Mystery, Fantasy, übernatürliche Kräfte (ja, das kommt einem heute sehr bekannt vor), Plot-Twists und endlose Faninterpretationen miteinander verwebt, ohne sich je festzulegen.
Dass Donnie Darko nicht sofort einschlug, lag weniger am Film als an der Realität. Kinostart war im Oktober 2001, nur wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September. Eine abstürzende Flugzeugturbine als zentrales Motiv war zu diesem Zeitpunkt kaum vermittelbar. Dazu kam: soziale Medien existierten praktisch nicht. Kein virales Echo, kein algorithmischer Rückenwind. Der Film brauchte Zeit. Jahre. Erst langsam wurde er zum Kult.
Wichtig ist aber etwas anderes: Donnie Darko war keine nostalgische Verklärung. Ja, der Film liebte seine Musik, zitierte Horrorfilme wie Tanz der Teufel und spielte bewusst mit dem Look der Zeit. Aber er war gnadenlos in dem, was er freilegte. Ich denke dabei immer an Patrick Swayze. Ein ehemaliger Star, schon leicht auf dem absteigenden Ast, besetzt als makelloser Motivationsredner, moralisch unangreifbar, fast schon karikaturesk perfekt. Und dann kippt das Bild. Bei einem Hausbrand wird kinderpornografisches Material gefunden. Das Ideal zerbricht. Die Fassade auch.
Genau das hat sich mir eingebrannt: Die 80er waren nie nur Neon, Synthesizer und BMX-Romantik. Sie waren ambivalent. Unter der sauberen Oberfläche lag viel Dunkelheit, viel Verdrängung, viel falsche Sicherheit. Vielleicht ist es genau diese Ambivalenz, die sie bis heute offen für Neuinterpretationen macht. Nicht als Fluchtpunkt, sondern als Projektionsfläche. Nicht, weil früher alles besser war, sondern weil man dort gelernt hat, dass es das nie war.
Vielleicht hängt meine Faszination für diese Zeit genau damit zusammen. Nicht mit Neon, nicht mit Synthesizern, nicht mit der Behauptung, früher sei alles einfacher gewesen. Sondern mit dem Gefühl, dass man Dinge noch aushalten musste, ohne sie sofort aufzulösen. Donnie Darko war dafür mein Einstieg. Kein Wohlfühlfilm, kein nostalgischer Trost. Eher eine Einladung, sich mit einer Welt auseinanderzusetzen, die schief ist, aber nicht glattgebügelt. Die dunkle Seiten hat, aber sie nicht hinter Buzzwords versteckt.
Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht rede ich mir diese Faszination nur schön. Aber Donnie Darko war für mich nie nur pure Nostalgie. Es war eher das Gegenteil. Ein Film, der mich nicht beruhigt hat, sondern verunsichert. Der gezeigt hat, dass unter der Oberfläche etwas fault, und dass man trotzdem hinschauen muss. Kein Trost, kein Zurück. Nur dieses Gefühl: Die Welt ist schräg, und wir müssen lernen, damit zu leben.
Ein Monster kannst du schlagen. Gegen den Algorithmus bist du machtlos.
Aber schalten wir den Algorithmus für einen Moment aus. Wenn wir uns trauen, hinter die Heldenfassade zu blicken und diese Figuren als echte Menschen zu sehen – wo wären sie dann? Die Idee einer Welt, die noch Geheimnisse hat, die nicht sofort gegoogelt werden können – das ist der eigentliche Suchtstoff.
Wir flüchten vor der Komplexität des Algorithmus in die Einfachheit des Demogorgons. Ein Monster mit Zähnen ist einfacher zu verstehen als ein unsichtbarer Virus, eine abstrakte Klimakatastrophe oder die schleichende Aushöhlung der Demokratie. Ein Monster kannst du schlagen. Gegen den Algorithmus bist du machtlos.
Stranger Things Kapitel 4: Wo sie wirklich gelandet wären (oder auch nicht)
Ich habe viel darüber nachgedacht, was aus diesen Charakteren wird, wenn sie in einer der Vielen-Welten-Theorien tatsächlich existieren. Was aus ihnen wird, wenn die 90er kommen. Wenn der Grunge übernimmt, wenn die Unschuld stirbt und die Ironie geboren wird. Nicht in einer heilen Spin-off-Welt, sondern in der Realität, die wir durchlebt haben. Wo wären sie, wenn sie echte Menschen wären?
Steve Harrington: Der Lehrer, den wir alle gebraucht hätten (und sein müssten)

Wir wissen aus dem Epilog, er wird Coach. Aber das ist nur die Oberfläche. Das ist nur der Job.
Steve ist für mich die Seele des Ganzen. Der unwahrscheinlichste Held. Der ehemalige Schulhof-König mit dem perfekten Haar, der irgendwann aufgehört hat, in den Spiegel zu schauen – nicht weil er sich nicht mehr mochte, sondern weil er gelernt hat, auf andere zu schauen. Wirklich zu schauen.
Sein Nagel-Baseballschläger – „The Bat“ – liegt irgendwo im Keller. Vielleicht hat er ihn in Beton gegossen, vielleicht einfach in eine Truhe gelegt, die er nie wieder öffnet. Nicht aus Angst. Sondern aus Überzeugung. Damit er nie wieder verführt wird, Gewalt als Lösung zu sehen.
Denn seine wahre Berufung liegt abseits des Sportplatzes. Steve unterrichtet Sexualkunde. Und das ist so absurd passend, dass es wehtut.
Er war der Typ, der dachte, Frauen wären Trophäen. Der „King Steve“, der mit Sonnenbrille durchs Leben stolperte, ohne zu wissen, wie viele er dabei überfuhr. Und dann kamen die Monster. Und die Kinder. Und Robin. Und alles veränderte sich.
Ich sehe ihn vor mir: Er sitzt auf dem Pult, Ärmel hochgekrempelt, die Haare immer noch verdammt gut (etwas grauer jetzt, aber in Würde). Und er redet mit den Kids. Nicht über Verhütung – das steht im Buch. Er redet über Respekt. Über Grenzen. Über Unsicherheiten. Er erklärt, wie man kein Arschloch wird. Er erklärt, dass ein „Nein“ ein ganzer Satz ist. Dass Männlichkeit nicht bedeutet, der Lauteste zu sein, sondern der, der zuhört.
Er ist der Lehrer, der merkt, wenn jemand zu leise ist. Der sieht, wenn ein Schüler sich kleiner macht, als er ist. Weil er gelernt hat, auf die Kleinen aufzupassen. Danke, Dustin.
Vielleicht weiß er es gar nicht, aber er ist der Erwachsene, den er selbst nie hatte. Nicht perfekt. Aber da. Und das reicht.
Vielleicht ist das der Grund, warum diese Figur bei mir so hängen bleibt.
Ich weiß nicht, ob ich dieser Lehrer heute noch bin. Aber ich weiß, dass ich es einmal war. Und dass ich gerade versuche, wieder zuzuhören.
Nancy Wheeler: Die Unbequeme in Flannel

Nancy bleibt nicht in Hawkins. Auf keinen Fall. Hawkins ist zu klein, zu eng, zu voller Erinnerungen an tote Freundinnen und tote Labore. Nancy ist zu groß für diese Stadt. Kleiner Zeitsprung: Ich sehe sie in den frühen 90ern. Seattle oder Washington D.C. Sie hat die Dauerwelle rausgewaschen, trägt jetzt Dr. Martens und viel zu große Flannel-Hemden, riecht nach Zigarettenrauch und starkem Kaffee. Sie ist investigative Journalistin.
Der Regen passt zur Stimmung. Sie schreibt nicht über Lifestyle. Sie deckt Skandale auf. Chemiefirmen, die Flüsse vergiften (ein Trauma sitzt tief). Korrupte Politiker, die Experimente vertuschen. Sie ist diejenige, die sich in verrauchten Redaktionsbüros mit alten Männern anlegt und gewinnt, weil sie keine Angst mehr hat.
Was soll ihr ein wütender Chefredakteur schon anhaben, wenn sie dem Mind Flayer ins Auge gesehen hat? Sie ist einsam, vielleicht. Ihre Beziehungen halten nicht lange, weil niemand ihre Intensität versteht. Aber sie hat eine Mission. Die Wahrheit ans Licht zu zerren, egal wie hässlich sie ist.
Robin Buckley: Zwischen den Frequenzen

Ich glaube, in Robin hätte ich mich verliebt. Und wäre es vielleicht sogar geblieben – selbst nachdem sie mir, wie in der Serie Steve, einen sehr eindeutigen Korb gegeben und sich als lesbisch geoutet hätte.
Nicht aus Hoffnung. Sondern weil ich trotzdem gerne mit ihr abgehangen hätte. So wie Steve es tut. Nähe ohne Anspruch.
Und ja, schon wieder Steve: du trotteliger Seelenverwandter. Mit besseren Haaren, aber dem gleichen Talent, genau das Richtige auszuhalten.
Robin ist stark, unabhängig und macht am Ende doch ihr Ding. Abschluss gemacht, Zukunft offen, aber Hawkins – das bleibt zu eng. Zu viel Beton in den Köpfen, zu wenig Platz für das, was in ihr lebt. Zu queer für die Gänge der Highschool, zu schnell im Kopf für ein Leben im Supermarkt oder hinter der Theke. Und vor allem: zu ehrlich, um sich kleinzumachen.
Sie zieht los. Vielleicht nicht weit. Vielleicht erst nur ein paar Städte weiter. Musik, Sprachen, Menschen, die nicht automatisch lachen, wenn sie spricht. Sie findet Anschluss in Unigruppen, wo keiner fragt, warum sie sich in Details verliert.
Vielleicht arbeitet sie bei einem kleinen Radiosender. Nicht on air, sondern im Hintergrund, Sounddesign, Redaktion, manchmal Schnitt. Später vielleicht Podcasts, nicht über sich, sondern über andere: Außenseiter, Stimmen ohne Bühne. Interviews mit Leuten, die sonst nur flüstern. Sie hört zu. Und redet dann, wenn es zählt.
Privat ist sie kompliziert. Ihre Beziehungen haben Ecken. Sie verliebt sich, oft zu schnell, manchmal zu heftig. Aber sie bleibt aufrecht. Lacht viel. Und wenn sie nach Hawkins zurückkommt – zu Besuch, nicht für immer – bringt sie Steve was mit. Keine Ratschläge, keine Bücher, einfach ein Blick, der sagt: Ich bin noch da. Und du auch.
Joyce & Hopper: Neuanfang in Monatuk?

Hawkins ist Geschichte. Zu viele Wunden, zu viele Schatten. Joyce und Hopper, jahrelang gejagt vom Wahnsinn, vom Verlust, vom Gefühl, immer nur reagieren zu müssen – sie dürfen endlich atmen. Im letzten Bild sitzen sie im Enzo’s, das Licht flackert romantisch, Hopper zieht diesen Ring hervor, den er viel zu lange mit sich herumgetragen hat. Kein dramatischer Monolog, keine Zeitlupe – nur ein Antrag, leise und ehrlich. Joyce sagt Ja. Nicht zum Märchen, sondern zum Versuch, ein echtes Leben zu führen.
Ihr Ziel: Montauk. Ein Küstenort, fast schon mythisch. In der Serie nur ein Nebensatz – aber mit Gewicht. Denn Montauk war ursprünglich der geplante Handlungsort für Stranger Things, bevor es zu Hawkins wurde. Und Montauk ist auch in der echten Welt kein neutraler Ort. Er steht für Verschwörungsmythen, für angebliche Regierungsexperimente mit Zeitreisen, für das berüchtigte „Montauk Project“.
Ein Ort voller Geschichten, voller Nebel, voller Geheimnisse. Dass Hopper gerade dorthin will, wirkt wie ein Rückgriff auf das, was die Serie einmal war – und ein letzter Zaubertrick der Duffer Brothers: Die Serie kehrt heim, aber auf andere Weise als erwartet.
Für Joyce und Hopper ist es ein Neuanfang. Ein Haus am Meer. Kein Keller mit Lichtern, die flackern. Keine Portale. Keine Labore. Nur das Rauschen des Atlantiks, vielleicht ein alter Hund auf der Veranda. Hopper hat vielleicht einen Job im Hafen, Joyce kümmert sich um das Haus, ruft ihre Jungs an, wenn das Heimweh zu laut wird. Aber die Angst – die bleibt. Wenn irgendwo ein Licht flimmert, wenn ein Kind schreit, wenn der Wind komisch klingt. Sie haben ihre Monster nicht zurückgelassen. Sie tragen sie in sich.
Und trotzdem: Sie bleiben. Sie wagen es. Weil Montauk – trotz seiner Mythen, trotz seiner Geschichte – für sie ein Versprechen ist. Nicht auf Sicherheit. Aber auf Ruhe. Und vielleicht, ganz vielleicht, auf ein kleines Stück Glück, das keine Pointe mehr braucht.
Lucas & Max: Zwei, die sich fast verloren hätten

Mit Lucas bin ich nie ganz warm geworden. Er blieb mir bis zum Schluss ein wenig fremd – trotz, oder vielleicht gerade wegen der Rolle, die er am Ende übernimmt.
Er ist derjenige, der bleibt. Der Max die Hand hält, wenn alles längst zu viel ist. Eine Loyalität, die in diesem Alter fast übermenschlich wirkt. Still, unspektakulär, ohne große Worte.
Und ja, da ist diese andere Seite: der Moment, in dem er dazugehören will. Zu den Coolen. Zum Basketballteam. Der Moment, in dem er bereit ist, seine alten Freunde dafür fast zu verlieren.
Vielleicht ist es genau das, was mich auf Abstand hält. Nicht, weil ich es ihm vorwerfe – sondern weil es so nah an etwas ist, das ich kenne. Dieses Ziehen zwischen Sicherheit und Anerkennung. Zwischen Loyalität und dem Wunsch, endlich nicht mehr der Außenseiter zu sein.
Lucas ist kein bequemer Charakter. Aber vielleicht ist er gerade deshalb einer der ehrlichsten.
Lucas und Max. Das Paar, das niemand kommen sah, das aber irgendwann einfach da war – verletzlich, kämpferisch, schräg vertraut. Dann kam der Bruch. Der Mind Flayer, Billys Tod, Max’ Rückzug, ihre Entscheidung, alles zu vergessen. Lucas blieb. Wartete. Hoffte. Und am Ende, als Max im Krankenhaus liegt, halb da, halb nicht, da hält er ihre Hand, liest ihr vor. Weil er glaubt, dass sie ihn noch hört. Weil man das macht, wenn man liebt.
Im Epilog sind sie zusammen. Wirklich zusammen. Keine Andeutung, kein „vielleicht“. Lucas sitzt an Max’ Seite, Max lehnt sich an ihn. Sie haben den schlimmsten Teil überlebt. Und erst einmal reicht das.
Aber Max ist nicht „gerettet“. Nicht im klassischen Sinn. Ihr Körper funktioniert wieder, ja. Sie geht, sie spricht, sie lacht sogar. Aber das, was sie gesehen hat, lässt sich nicht einfach abschalten. Sie hat zu lange in die Dunkelheit geschaut. Und manchmal ist Lucas der Erste, der merkt, wenn sie innerlich wieder dort ist.
Sie bleiben ein Paar, weil sie es wollen. Weil Nähe hilft. Weil Lucas geduldig ist, weil er zuhören kann, ohne sofort etwas reparieren zu müssen. Er liest ihr vor. Sie sitzen viel schweigend nebeneinander. Max ist da – aber nicht immer ganz.
Und genau das wird irgendwann schwer.
Nicht, weil die Liebe fehlt. Sondern weil sie unterschiedlich heilen. Lucas will nach vorne. Er glaubt an Struktur, an Engagement, an das Kämpfen gegen reale Ungerechtigkeiten. Vielleicht studiert er später Politik oder Sozialarbeit. Er lernt, dass die Monster der Welt heute keine Tentakel mehr haben. Sie tragen Anzüge, verwalten Budgets, entscheiden über Leben aus klimatisierten Büros. Lucas will etwas dagegen tun.
Max dagegen braucht Abstand. Weite. Stille. Vielleicht zieht sie für eine Zeit ans Meer, zu einer Tante, vielleicht einfach weg von allem, was sie an Hawkins erinnert. Nicht als Flucht vor Lucas – sondern als Versuch, wieder zu sich selbst zu finden. Sie reden darüber. Sie versprechen sich nichts, was sie nicht halten können.
Sie schreiben sich. Am Anfang oft. Dann seltener. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil Worte manchmal nicht reichen. Und irgendwann kommt von Max nur noch wenig. Aber wenn sie schreibt, dann ehrlich.
Kein großes Drama. Kein endgültiger Bruch. Sondern dieses leise Auseinanderleben, das passiert, wenn zwei Menschen einander lieben, aber merken, dass sie an unterschiedlichen Stellen der Zeit stehen.
Und trotzdem: Wenn Max lacht – in Lucas’ Erinnerung – dann flackert da immer noch Licht. Nicht als Schmerz. Sondern als Beweis, dass es echt war. Und dass es gut war, solange es ging.
Dustin Henderson: Der Architekt der Verbindung

Dustin… Gott, bei Dustin habe ich die meiste Hoffnung. Und den größten Schmerz.
Er war nie der Auserwählte. Nie der Anführer. Kein Paladin, kein Magier, kein Held im klassischen Sinn. Und gerade deshalb wurde er zum Zentrum. In jeder konventionellen 80er-Jahre-Erzählung wäre er der Sidekick geblieben – der lustige Typ, der für Gags zuständig ist. Der, den man mag, aber nie ganz ernst nimmt.
Aber Dustin hat die Regeln neu geschrieben. Er hat Grenzen eingerissen, die sonst unüberwindbar geblieben wären. Wer sonst hätte Steve Harrington – einst Schulhof-König, dann Babysitter wider Willen – zu einem Bruder machen können? Dustin hat durch seine Hartnäckigkeit, seine Loyalität, seinen Humor gezeigt, dass Nerdsein kein Makel ist. Kein Makel und keine Phase, sondern eine Art, die Welt zu sehen. Leidenschaftlich. Fragend. Tief.
Ich sehe ihn nicht nur am MIT. Vielleicht war er da, klar. Vielleicht hat er Satelliten gebaut oder neue Energieformen erfunden oder eine Methode entwickelt, um WLAN über Dimensionsgrenzen hinweg zu senden. Aber das ist nicht das Entscheidende.
Wichtiger ist: Er ist derjenige, der die WhatsApp-Gruppe am Leben hält. Der an Weihnachten immer noch schreibt: „Habt ihr alle Staffeln DnD archiviert? Ich hab ’ne neue Kampagne.“ Der bei Klassentreffen zu viel redet, zu laut lacht – und dann plötzlich still wird, wenn jemand „Eddie“ sagt.
Er hat Eddie nie vergessen. Niemand hat das. Aber Dustin hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass auch niemand sonst es tut. Er archiviert die Erinnerung. Er pflegt sie. Wie ein Bibliothekar des Herzens. Weil er weiß, was es heißt, jemanden zu verlieren, der einen gesehen hat. Wirklich gesehen.
Vielleicht lebt er in einer kleinen Wohnung voller Technik und Bücher. Vielleicht ist er verheiratet, vielleicht nicht. Aber irgendwo, auf einem Regal, steht eine kleine, handgeschnitzte Miniatur von Eddie Munson, direkt neben einer zerkratzten D20-Würfelbox.
Und wenn es still ist, wenn alle schlafen, dann öffnet Dustin die Box, legt Eddies Lieblingssong auf – „Master of Puppets“, natürlich – und beginnt zu spielen. Allein. Aber nicht einsam.
Denn er weiß: Solange die Geschichte weitererzählt wird, ist niemand wirklich weg.
Jonathan Byers: Der unsichtbare Beobachter

Jonathan. Wir vergessen ihn oft, oder? Die Serie hat ihn oft vergessen. Er war der „andere“ Bruder, der stille Typ mit der Kamera. Aber genau das ist sein Schicksal. Jonathan wird kein großer Hollywood-Regisseur. Das wäre zu laut für ihn. Jonathan wird Filmemacher. Vielleicht dreht er nur Schwarz-Weiß, körnig, analog. Er zieht durch das Amerika der 90er, das, das niemand sehen will. Die Rostgürtel, die verlassenen Tankstellen, die Menschen am Rand. Er hat einen Blick für das Verborgene, weil er sein ganzes Leben lang im Hintergrund stand.
Und manchmal, wenn er ein Foto entwickelt und das Bild langsam aus der Chemie auftaucht, erinnert ihn das an das Upside Down
Er sieht die Monster im Alltag – Armut, Verfall, Einsamkeit. Er lebt vielleicht in einer kleinen Dunkelkammer in New York oder Chicago. Er ist nicht reich, er ist nicht berühmt. Aber er ist echt. Er hat aufgehört, der Ersatzvater für Will zu sein, und angefangen, sein eigenes Leben zu leben. Und manchmal, wenn er ein Foto entwickelt und das Bild langsam aus der Chemie auftaucht, erinnert ihn das an das Upside Down. Nur dass die Welt da draußen manchmal genauso düster ist.
Will Byers: Der leise Neubeginn

Will zieht nach New York. Nicht, weil er Großstadttrubel sucht, sondern weil er dort endlich atmen kann, ohne ständig auf sein altes Spiegelbild zu treffen. Hawkins war der Ort, an dem alles begann – das Verschwinden, die Schatten, das unablässige Gefühl, falsch zu sein. New York ist laut, anonym, überfordernd. Aber genau das braucht er.
In Brooklyn hat er ein kleines Zimmer, Blick auf die Feuertreppe, Heizung pfeift im Winter wie ein aufgeschreckter Demogorgon. Es ist nicht glamourös. Aber es ist seins. Und: Es ist weit weg genug. Weit weg von Kellerdunkel und Kellerdenken.
New York gibt ihm, was Hawkins nie konnte: Raum. Für sich. Für seine Kunst. Für seine Identität. Er muss sich nicht mehr verstecken, nicht mehr zurückhalten, nicht mehr lächeln, wenn er eigentlich schreien will. Vielleicht treibt er sich später im East Village herum. Zwischen Secondhand-Galerien, schrägen Bars und Menschen, die genauso zerbrechlich und eigensinnig sind wie er. Er malt weiter. Keine düsteren Monster mehr, sondern flirrende Farben, Splitter von Licht, Szenen aus einem Leben, das nicht mehr unter Beobachtung steht.
Er liebt. Und er darf es endlich. Nicht heimlich, nicht als Frage, sondern offen, tastend, zärtlich. Und obwohl er nie der Lauteste war, ist da eine neue Sicherheit in seiner Stimme. Als hätte er sich selbst wieder eingesammelt.
Will bleibt sensibel. Er spürt, wenn etwas nicht stimmt, oft bevor es jemand sagen kann. Diese Empathie hat ihn früher verletzlich gemacht – jetzt macht sie ihn besonders. Vielleicht unterrichtet er irgendwann, vielleicht eröffnet er einen Kunstraum für queere Jugendliche, die sich in ihrer Stadt genauso fremd fühlen wie er einst in seinem Körper. Vielleicht reicht es ihm, einfach da zu sein.
Er hat in den Abgrund geschaut, ist nicht gesprungen – und jetzt, in dieser vibrierenden, lauten Stadt, lebt er. Still, aber voller Farben. Und das ist vielleicht die lauteste Antwort, die man geben kann.
Eleven: Jane Hopper

Sie war eine Nummer. Dann eine Waffe. Dann eine Heldin. Aber was bleibt von einem Leben, das immer von anderen definiert wurde?
Am Ende von Stranger Things ist Jane verschwunden. Wahrscheinlich tot, vielleicht nicht. Er wird damit nicht fertig, bis Hopper ihn sucht und eMike glaubt nicht daran. Nicht wirklich. Er erzählt eine Geschichte – von einer Insel, von Wasserfällen, von einem Ort, an dem niemand sie finden kann, aber auch niemand sie jagt. Und irgendwo zwischen Wahrheit und Trost liegt vielleicht genau das, was sie immer wollte: ein eigenes Leben.
Ich stelle mir vor, dass sie tatsächlich dort ist. Irgendwo, wo niemand sie „El“ nennt. Wo niemand erwartet, dass sie Türen mit Gedanken öffnet oder Monster besiegt. Wo sie als Jane lebt, still und unscheinbar. Vielleicht arbeitet sie mit Pflanzen. Botanik, Biologie, irgendetwas, das wächst, wenn man es in Ruhe lässt. Sie lebt allein. Nicht einsam, aber für sich. Vielleicht hat sie einen Hund. Vielleicht schreibt sie Briefe, die sie nie abschickt.
Sie hat Narben, aber sie trägt sie wie Ringe an einem alten Baum. Zeit hat sie verwandelt. Nicht geheilt, aber verwandelt. Sie spricht nicht über Brenner. Nicht über das Labor. Aber sie hat gelernt, dass Sanftheit keine Schwäche ist. Dass Stille nicht leer ist. Dass ein friedliches, langweiliges Leben das Mutigste sein kann, was man sich wünschen darf.
Und vielleicht, ganz vielleicht, sieht sie eines Tages am Horizont ein Boot. Und da sitzt jemand drin, mit einem Notizbuch auf dem Schoß, der einmal versprach, sie nie allein zu lassen.
Mike Wheeler: Der Paladin ohne Schwert

Mike war der Anführer. Der Dungeon Master. Der mit dem Plan. Der, der zusammenhielt, wenn alles in Stranger Things auseinanderzufallen drohte. Sein Selbstverständnis hing daran, gebraucht zu werden. Zu retten. Zu erklären. Zu erzählen.
Am Ende funktioniert das nicht mehr.
Im Epilog wirkt Mike wie jemand, der zu früh alt geworden ist. Er steht neben den anderen, aber nicht bei ihnen. Während sie Abschlüsse feiern, Pläne machen, sich vorsichtig an eine Zukunft herantasten, bleibt er innerlich an einem Punkt hängen, den man nicht einfach überspringen kann. Er will nicht zum Abschlussball. Nicht, weil er sich verweigert. Sondern weil er emotional nicht dort ankommt, wo die anderen schon stehen.
Für Mike war Zukunft nie abstrakt. Sie war konkret. Sie hatte ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist weg.
Er findet keinen Halt in Gesprächen, nicht in Ritualen, nicht im „Weiter so“. Also tut er das Einzige, was er immer konnte: Er erzählt. Beim letzten Dungeons-&-Dragons-Spiel weigert er sich, eine Geschichte mit einem klaren Tod enden zu lassen. Seine Figur stirbt nicht. Sie verschwindet. Nicht als Plot-Twist. Nicht als Hoffnung auf ein Comeback. Sondern als Möglichkeit, den Verlust überhaupt benennen zu können.
Das ist keine Theorie. Das ist Trauerarbeit.
Er weiß, dass Geschichten nichts rückgängig machen. Aber sie machen etwas anderes: Sie geben Luft. Sie verhindern, dass alles in einem Punkt endet. Mikes Erzählung ist kein Ausweg aus der Realität, sondern ein Weg, in ihr zu bleiben, ohne daran zu zerbrechen.
Erst Hopper erreicht ihn. Nicht mit Trost, nicht mit Versprechen. Sondern mit etwas, das schwerer ist als Hoffnung: mit Verantwortung. Hopper kennt diesen Zustand. Er weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren und trotzdem weiterleben zu müssen. Er macht Mike klar, dass es jetzt nicht um Wahrheit oder Lüge geht, sondern um eine Entscheidung. Stillstand oder Bewegung. Sich selbst verlieren oder lernen, mit dem Verlust zu leben.
Jane, macht Hopper deutlich, hat eine Entscheidung getroffen. Nicht für den Tod, sondern für die anderen. Jetzt liegt es an Mike, zu entscheiden, was er mit dem Rest seines Lebens macht.
Mike versteht das nicht sofort. Aber etwas löst sich. Nicht die Trauer. Die bleibt. Aber die Starre.
Vielleicht wird Mike immer jemand bleiben, der Geschichten braucht, um die Welt zu ertragen. Vielleicht ist das keine Schwäche, sondern seine eigentliche Stärke. Denn er ist der, der den Schmerz nicht wegdrückt, sondern ihm eine Form gibt.
Und vielleicht ist genau das sein Erwachsenwerden: zu akzeptieren, dass man nicht jede Geschichte retten kann – aber trotzdem weitererzählt.
Die neuen kleinen Nerds (Der Loop)

Und dann ist da dieser eine Moment im Epilog. Unspektakulär inszeniert, fast übersehbar. Ein paar Kinder, jünger als unsere Helden es je waren. Die neuen Kleinen. Nicht Dustin, nicht Will, nicht El. Sondern jene, die nach ihnen kamen. Die in Staffel 5 entführt, gebrochen, vergessen wurden.
Sie sitzen um einen Tisch. Es gibt Cola, vielleicht Chips, ein aufgeklapptes Abenteuerheft, Würfel. Dungeons & Dragons. Wieder. Oder besser gesagt: noch immer.
Und ich merke, wie mir das Herz aufgeht. Weil ich verstehe, was das ist. Das ist kein bloßes Spiel. Das ist Heilung. Das ist eine Welt mit klaren Regeln, in der du nicht ausgeliefert bist. In der nicht der Zufall, sondern der W20 entscheidet. In der man die Monster sieht, benennt, bekämpft – und manchmal auch besiegt.
Der Kreis schließt sich. Die Fackel wird weitergereicht. Das ist nicht Nostalgie. Das ist Widerstand.
Denn das Monster von heute sitzt nicht mehr im Wald. Es lebt im WLAN. Es heißt Algorithmus, heißt Cybermobbing, Vergleich, Druck, Endzeitgefühl. Es frisst unsere Aufmerksamkeit, unsere Ruhe, unsere Kindheit. Es verleiht sich selbst Likes und tarnt sich als Normalität.
Aber solange es Kinder gibt, die in Kellern, Garagen oder Discord-Chats ihre eigenen Regeln schreiben, die sich Spielfiguren ausdenken, die mutiger sind als sie selbst es gerade sein können – solange ist nicht alles verloren.
Vielleicht liegt in dieser Szene die stillste Hoffnung der Serie. Dass eine neue Generation sich nicht nur erinnert, sondern weitermacht. Dass sie nicht fragt, ob das alles echt war, sondern nur: „Wer hat den nächsten Zug?“
Und dass jede Generation ihre eigenen Würfel rollen lassen muss.
Und wenn ich ganz leise bin, glaube ich, dass genau das die Antwort ist, die uns Stranger Things hinterlässt. Nicht die Nostalgie nach einer alten Welt. Sondern der Glaube daran, dass Geschichten stärker sind als die Dunkelheit.
Stranger Things Kapitel 5: Und wenn alles nur ein Spiel war?

Es gibt diese Theorie – alt, abgenutzt, immer wieder aufgewärmt –, dass alles nur ein einziges, ausuferndes Dungeons-&-Dragons-Spiel im Keller der Wheelers war. Die Monster, die Superkräfte, das Upside Down – bloß die metaphorischen Auswüchse pubertierender Nerd-Fantasie. Ein Eskapismus-Schutzschild gegen die Tristesse der Vorstadt.
Natürlich lehnen viele Fans das ab. Zu platt, zu einfach. „Es war alles nur ein Traum“ ist der billigste Trick der Erzählgeschichte. Fast schon eine Beleidigung für die Zeit, die wir investiert haben. Und trotzdem… ein Teil von mir will das gar nicht ausschließen. Ein Teil von mir findet den Gedanken fast schön. Wäre das nicht ein schönes Stranger Things Finale?
Was, wenn das genau die Wahrheit ist? Was, wenn dieses Spiel – ob am Tisch, auf dem Bildschirm oder im Kopf – das Einzige ist, was uns je verbunden hat? Was, wenn alle Kämpfe gegen das Böse, alle Reisen ins Upside Down, alle Opfer, Verluste und Versöhnungen bloß Ausdruck des uralten menschlichen Reflexes sind: Geschichten zu erzählen, um die Welt erträglicher zu machen? Wir erfinden Monster, damit wir sie besiegen können, weil wir die echten Probleme (Scheidung, Armut, Tod) nicht besiegen können.
Und dann frage ich mich: Wäre das wirklich so schlimm?
Wäre es nicht sogar tröstlich zu glauben, dass wir mit ein paar Würfeln, Freunden und Fantasie in der Lage sind, uns ein Stück Sinn zu basteln? Dass die Monster vielleicht gar nicht besiegt werden müssen – sondern nur benannt? Dass Vecna nur ein Name für Depression ist? Dass der Mind Flayer nur ein Name für Konformitätsdruck ist?
Vielleicht war Stranger Things nie eine Serie über ein Monster. Vielleicht war es eine Serie über Freundschaft, über das Gefühl, nicht allein zu sein, wenn man das Gefühl hat, allein zu sein. Über das Glück, in einem stickigen Keller gemeinsam mit anderen durch die Dunkelheit zu tappen – und zu wissen: Da ist jemand neben mir. Und der hat auch Angst. Aber wir halten zusammen. Wir teilen uns die Angst, bis sie klein genug ist, dass man sie in die Tasche stecken kann.
Vielleicht war es nie wichtig, ob das alles real war. Vielleicht ging es nie um Tentakel, Portale und Regierungslabore. Vielleicht war Stranger Things immer nur die moderne Version eines alten Menschheitstricks: Sich die Monster auszudenken, um ihnen einen Namen zu geben. Und dann gemeinsam gegen sie zu kämpfen.
Vielleicht ist das Spiel der letzte Ort, an dem wir uns noch sicher fühlen. Weil wir da noch wissen, wer wir sind. Der Barbar. Der Zauberer. Der Heiler. Weil uns da keiner allein lässt, wenn’s gefährlich wird.
Und vielleicht war Hopper deshalb so wichtig. Nicht, weil er Monster erschossen hat, sondern weil er immer wieder zurückkam. Weil er sagte: Ich bin da. Auch wenn’s weh tut. Auch wenn ich selbst kaum noch kann.
Vielleicht war das ganze Ding – fünf Staffeln lang – nichts weiter als ein einziger großer Versuch, dieses Gefühl zu retten: Dass jemand neben dir sitzt, dir die Hand auf die Schulter legt und sagt: Du bist nicht allein. Ich hab den nächsten Zug.
Vielleicht ist das der wichtigste Satz, den man aus dieser Serie mitnehmen kann: „Du musst das nicht allein machen.“
Und dann ist es auch okay, wenn im Stranger Things Finale keiner mehr stirbt. Wenn es ein Happy End gibt. Wenn das Monster weg ist. Weil das wahre Monster vielleicht gar nicht das mit den Zähnen war. Sondern die Einsamkeit. Und dann reicht es manchmal, wenn jemand zuhört. Wenn jemand zurückruft. Wenn jemand den Würfel in die Hand nimmt und sagt: „Ich geh vor.“
Stranger Things Outro: Was bleibt

So ist das jetzt: Ich sitze wieder auf dem Sofa. Die Ecke ist dunkel. Das Jahr ist nicht mehr 2016. Ich bin älter geworden. Meine Frau liest neben mir, das Licht ist warm. Wir kämpfen nicht mehr gegen das Upside Down, sondern durch den Alltag. Stranger Things ist vorbei. Die Kampagne ist beendet. Die Würfel sind eingepackt. Alles sauber aufgelöst.
Aber hier draußen gibt es keinen Abspann. Hier draußen bleiben die Jahre, die einfach weg sind. Die Freunde, die man nicht im Kampf verloren hat, sondern weil man zu müde war, sich zu melden. Die Zeit, die Corona gefressen hat, ohne zu fragen. Und diese Scheißangst, dass man mit jedem Jahr ein bisschen härter wird, ein bisschen weniger spürt. Dass das alles nur noch Stückwerk ist.
Und vielleicht ist dieser Text genau deswegen für jemand anderen.
Für ein kleines Kind, das noch nicht weiß, wie finster es manchmal wird. Das glaubt, dass jeder Controller etwas bewirkt. Dass jedes Spiel gewonnen werden kann. Das nachts schläft, weil es spürt, dass jemand Wache hält.
Sie wird das eines Tages lesen, vielleicht. Was der Papa damals über das Stranger-Things-Finale schreiben musste, während wir tagsüber Astrobot zockten. Zwischen zwei Welten. Und dann wird sie nicht alles verstehen. Aber sie wird merken, dass da jemand war. Jemand, der Angst hatte vor den verlorenen Jahren und der Kälte. Aber der trotzdem geglaubt hat. An Monster. An Licht. Und an sie.
Das Monster im Fernsehen ist weg. Das echte Leben bleibt kompliziert. Und manchmal reicht es gerade so, die Taschenlampe selbst nicht fallen zu lassen.
Vielleicht ist das der einzige Sieg, den wir kriegen: Dass wir da sind. Auch wenn wir selbst im Dunkeln stehen.
Heute. Jetzt. Und bald ist wieder Montag.